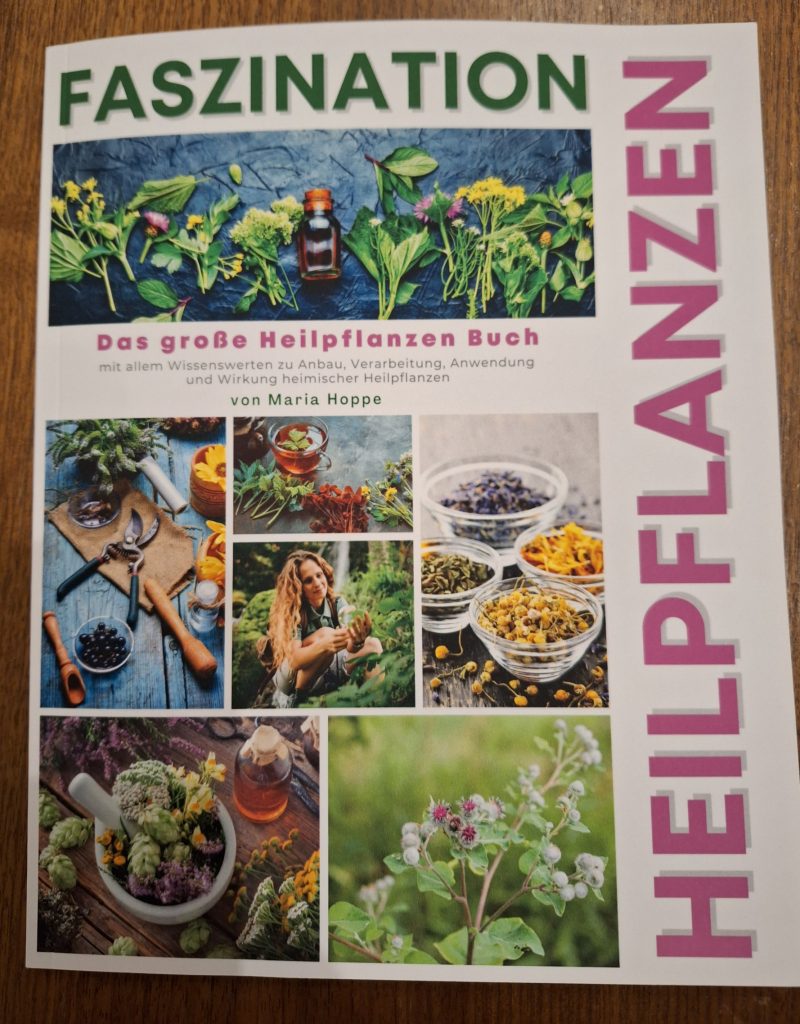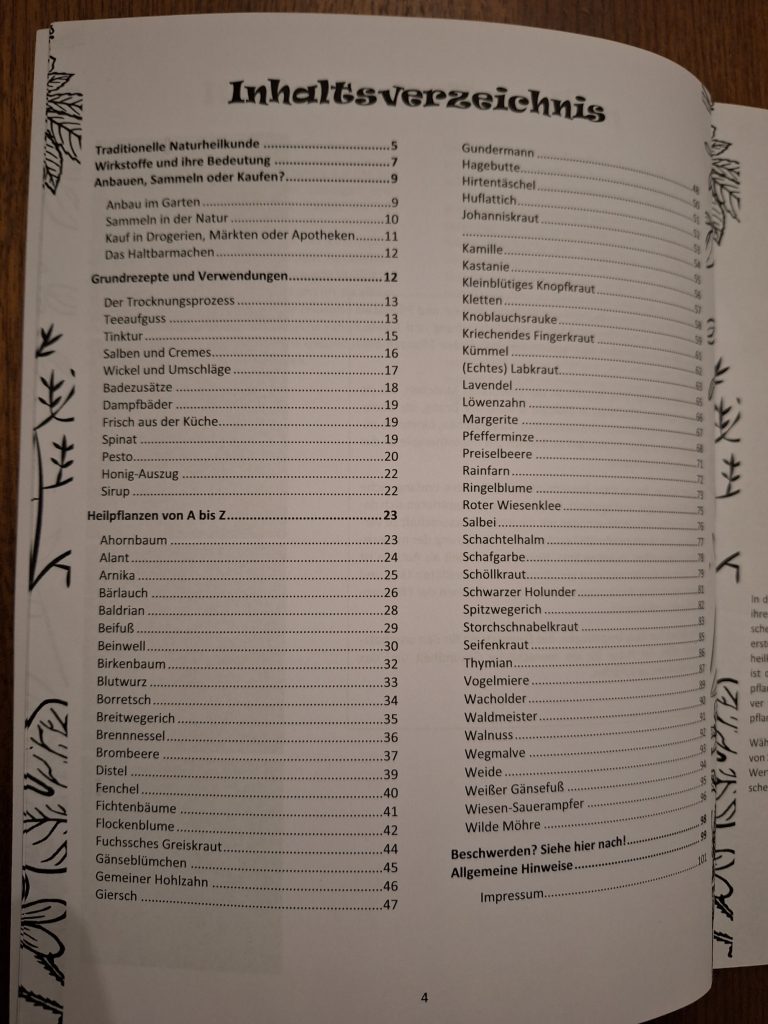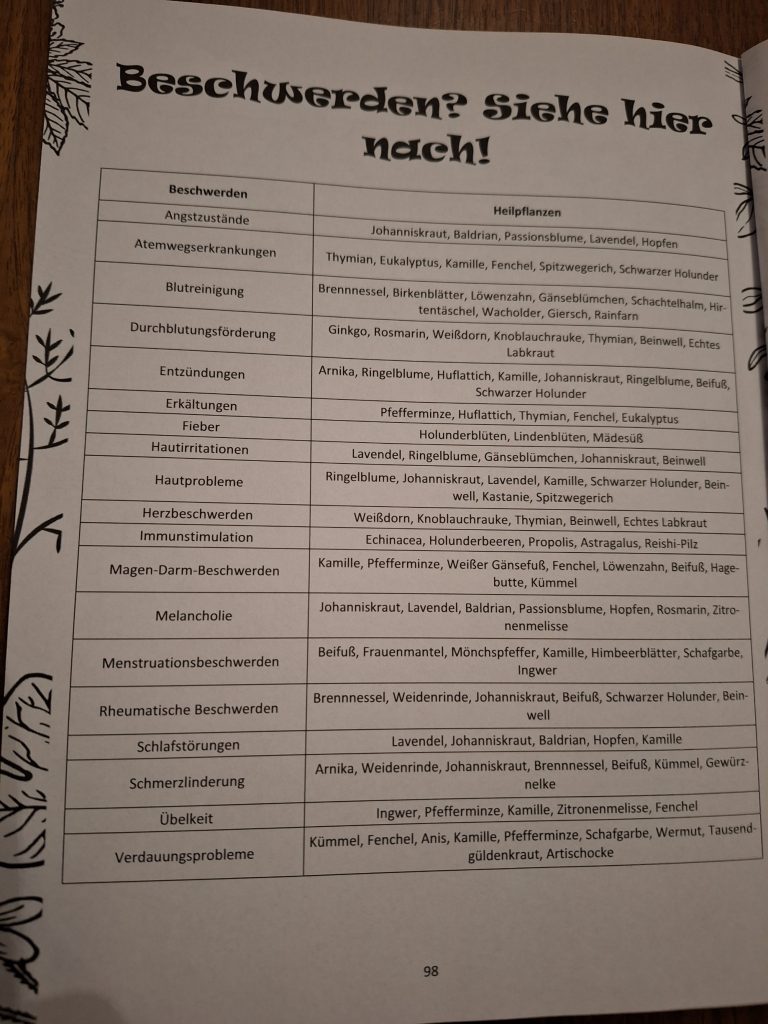Mangel an medizinischem Antibiotika war und ist immer wieder ein Thema. Gerade im Winter. Wer Kinder hat und diesen einen ungewohnten, vom Apotheker manuell hergestellten, Antibiotika Saft verabreichen musste, weiß wovon ich rede. Wir sind medizinisch sehr verwöhnt und leider weitestgehend nicht mehr in der Lage auf die heilenden Kräfte der Natur zurückzugreifen, wie die Menschheit es seit Jahrtausenden konnte.
Wir haben es verlernt!
Stand Jahr 2022/2023 sind wir in Sachen Antibiotika von China stark abhängig. Im Winter 22/23 hat man das zum ersten mal kräftig gespürt. Was die Zukunft bringt weiß niemand. Es schadet nicht, sich darauf vorzubereiten, dass sein Kind mit einer bakteriellen Infektion nicht sofort das passende Antibiotika erhält.
Deshalb habe ich mich etwas schlau gemacht und ein paar Rezepte recherchiert die wir mit heimischen oder verfügbaren Mitteln für die Herstellung von Mittelchen verwenden können. Diese Mittel wirken natürlich nicht wie das gewohnte Antibiotika, können im Notfall aber wirklich helfen und unterstützen. Oder auch vorbeugend funktionieren.
Ich habe diese Rezepte im Internet zusammengesucht und hier übernommen. Quelle ist jeweils verlinkt.
Ich bin KEIN Arzt. Ich berufe mich auf allgemeines Grundwissen aus der Naturheilkunde. Bitte redet mit einem Arzt bevor irgendwas unternommen wird! Es soll sich hierbei nur um eine Sammlung an Informationen zu möglichen natürlichen Hilfsmitteln handeln.
Allgemein – Wirksame Nahrungsmittel
Diese Nahrungsmittel werden in fast jedem Rezept erwähnt. Somit schadet es nicht diese im Haus zu haben.
(Quellen: https://biancazapatka.com , https://www.zentrum-der-gesundheit.de)
Ingwer: enthält gesunde ätherische Öle und Gingerol, die eine antibakterielle, entzündungshemmende, schmerzlindernde Wirkung haben. Außerdem ist Ingwer reich an Vitamin C, Magnesium, Eisen, Kalzium, Kalium, Natrium, Phosphor sowie Antioxidantien.
Kurkuma: das darin enthaltene Curcumin hemmt Entzündungen, wirkt antioxidativ und kann bei bei vielen Volkskrankheiten wie Rheuma, Diabetes und Arthrose helfen. Außerdem soll die ayurvedische Heilwurzel zur Regenerierung der Darmschleimhaut und der Darmflora beitragen.
Knoblauch: enthält das stärkste natürliche Antibiotikum „Allicin„. Durch seine antivirale Wirkung kann Knoblauch schädliche Bakterien, Viren und Pilze bekämpfen. Außerdem wirkt er leicht blutverdünnend und blutdrucksenkend, was sich günstig auf Herz-Kreislauf-Krankheiten auswirken kann.
Zwiebel: Zwiebeln sind die nächsten Verwandten des Knoblauchs. Sie verstärken die Knoblauchwirkung und stellen gemeinsam mit diesem ein starkes Duo gegen Krankheiten dar.
Meerrettich: Meerrettich ist für seine entzündungshemmenden und antibakteriellen Eigenschaften bekannt. Er wird traditionell bei akuter Nasennebenhöhlenentzündung, Bronchitis und Harnwegsinfekten eingesetzt. Seine heilsamen Inhaltsstoffe wirken sich besonders vorteilhaft auf die Atemwege aus, die Nasennebenhöhlen und die Lungen. Verstopfte Neben- und Stirnhöhlen werden gereinigt, die Blutzirkulation wird verbessert und nahende Erkältungen haben keine Chance mehr. Bei Harnwegsinfekten wird er gerne mit der Kapuzinerkresse kombiniert, woraus es bereits ein pflanzliches Arzneimittel gibt.
Honig: Speziell Blütenhonig leistet aufgrund seiner antibakteriellen, antimykotischen und antioxidativen Wirkung sowohl bei Infekten als auch bei vielen entzündlichen Prozessen gute Dienste. Eine ganz besondere Eigenschaft des Honigs soll seine Fähigkeit sein, die Bildung von Biofilmen zu verhindern. Biofilme sind Zusammenschlüsse krankhafter Bakterien im Körper. Honig soll das Kommunikationssystem dieser Bakterien stören können, so dass diese Bakterien nicht mehr als geschlossene Gruppe agieren können und so auch anfälliger für Gegenmittel, aber auch vom körpereigenen Immunsystem angreifbarer werden.
Apfelessig (Naturtrüb): Apfelessig wurde zu Heilzwecken schon vom Vater der Medizin – Hippokrates – um 400 vor Christus verwendet. Man sagt, er habe im Krankheitsfall nur zwei Mittel eingesetzt: Honig und Apfelessig. Essig insgesamt wirkt antibakteriell, weshalb er ja auch zur Konservierung eingesetzt werden kann. Naturtrüber Apfelessig enthält überdies Pektin, einen Ballaststoff, der hohe Cholesterinwerte senkt und den Blutdruck reguliert. Apfelessig unterstützt ferner den Mineralstoffhaushalt und damit die Knochengesundheit. Zwar liefert Apfelessig nur wenig Calcium, aber er hilft dabei, dass der Körper das Calcium aus der Nahrung besser resorbieren kann. Da Apfelessig ausserdem sehr kaliumreich ist, verleiht er dem Haar wieder Glanz, Nägeln Festigkeit und hilft überdies bei der Entgiftung des Körpers. Apfelessig enthält Apfelsäure, die sehr gut gegen Pilze und bakterielle Infektionen wirkt. Auch Harnsäurekristalle sollen von der Apfelsäure rund um die Gelenke herum aufgelöst werden können, was zu einer Linderung von Gelenkschmerzen führen kann.
Rezept: Honig, Zwiebel, Knoblauch
Zubereitung der Zwiebel-Honig-Mischung: Man schneidet eine mittlere bis grosse Zwiebel in feine Würfel. Zusätzlich kann man eine große Knoblauchzehe gehackt hinzugeben. Diese werden in ein Glas gegeben und mit etwa 100 ml Honig bedeckt. Das Ganze sollte 6 – 24 Stunden ziehen. Zwischendurch ein bis zwei Mal umrühren und anschließend das recht flüssige Ergebnis abseihen.
Dosierung: 2 – 3 Teelöffel 3 x täglich. Der Honig-Zwiebel-Saft soll übrigens auch zu hohe Cholesterinwerte und erhöhten Blutdruck senken. Tipp: Eine noch stärkere Wirkung erzielt man unter Zugabe von etwas frisch gepresstem Zitronensaft.
Quelle: https://www.nachhaltigleben.ch/gesundheit/natuerliche-antibiotika-6-rezepte-fuer-einfache-keimkiller-3539
Rezept: Apfelessig, Knoblauch, Zwiebeln, Chilli, Ingwer, …
Zubereitungszeit: ca. 15-20 Minuten – zzgl. 2 Wochen Ziehzeit
Bei nachfolgender Rezeptur handelt es sich um ein traditionelles und bewährtes Rezept. Wenn Sie daher die eine oder andere Zutat aus welchen Gründen auch immer weglassen oder austauschen möchten, dann verändern Sie die Rezeptur und möglicherweise auch die Wirkung.
Im Falle von Unverträglichkeiten oder Allergien auf einen Bestandteil sollten Sie das Rezept selbstverständlich entsprechend verändern, bevor Sie es einnehmen und sodann erst recht krank werden würden.
Die Zutaten für ca. 0,7 Liter
700 ml Apfelessig (Bio und naturtrüb)
25 g Knoblauch – schälen und reiben
70 g Zwiebeln – schälen und fein würfeln
17 g frische Pepperoni/Chili (ca. 2 Stück) – und zwar die schärfsten, die Sie finden können – kleingeschnitten
25 g frischer Ingwer – waschen und fein reiben
15 g frischer Meerrettich – schälen und fein reiben
27 g frische Kurkumawurzeln – waschen und fein reiben
¼ TL schwarzer Pfeffer aus der Mühle
2 EL Blütenhonig
Die Zubereitung
Geben Sie – bis auf den Apfelessig – alle Zutaten zusammen in eine Schüssel und mischen Sie sie gründlich.
Füllen Sie die Mischung in ein Einmachglas.
Giessen Sie den Apfelessig dazu, sodass der Inhalt gut bedeckt ist. Schliessen Sie das Glas und schütteln Sie es kräftig.
Stellen Sie das Glas anschliessend zwei Wochen lang an einen kühlen und trockenen Platz. Schütteln Sie es während dieser Zeit mehrmals täglich. Die Wirkstoffe aus Knoblauch, Chili etc. gehen auf diese Weise in den Essig über.
Nach zwei Wochen giessen Sie den Essig in eine Flasche ab. Er ist ab sofort Ihr neues, selbst gemachtes natürliches Antibiotikum. Um so viel Flüssigkeit wie möglich zu gewinnen, pressen Sie den Mix im Glas so stark es geht zusammen, z. B. mit einem Löffel oder einem Stampfer. Sie können den Mix auch in ein sauberes Baumwolltuch geben und dieses gut ausdrücken. Übrig bleibt eine Art Trester.
Haltbarkeit: Es heisst in der ursprünglichen Quelle, das natürliche Antibiotikum müsse nicht im Kühlschrank aufbewahrt werden und halte dennoch sehr lange. Eine konkrete Haltbarkeit wird jedoch nicht angegeben.
Wir empfehlen, das natürliche Antibiotikum sicherheitshalber in den Kühlschrank zu stellen. Die Haltbarkeit lässt sich dennoch leider nicht konkretisieren, da es sehr auf die Umstände der Zubereitung ankommt, wie hygienisch gearbeitet wird, welche Mikroorganismen sich ansiedeln etc.
So lange die Mischung frisch und würzig riecht und schmeckt, kann man sie erfahrungsgemäss bis zu drei Monate lang oder länger anwenden. Ergeben sich jedoch geschmackliche oder optische Veränderungen, ist es nicht mehr geniessbar.
Anwendung:
Achtung: Die Mischung ist sehr stark und scharf! Wenn Sie generell scharfe Speisen und Gewürze nicht vertragen, sollten Sie das natürliche Antibiotikum nicht verwenden oder dieses erst in sehr kleinen Mengen auf Verträglichkeit testen.
Verdünnen Sie die gewählte Dosis mit Wasser. Manche Menschen können das natürliche Antibiotikum auch pur nehmen (was die Wirkung erhöht, vor allem wenn eine Infektion im Rachenraum vorliegt). Für einige Menschen ist es unverdünnt jedoch zu scharf und/oder zu sauer.
Nehmen Sie täglich 1 EL vom natürlichen Antibiotikum, um Ihr Immunsystem zu stärken und Erkältungen zu bekämpfen. Geben Sie diese Dosis am besten in ein Glas Wasser (150 ml). Erhöhen Sie die Dosis langsam jeden Tag ein bisschen, bis Sie insgesamt die Menge eines kleinen Likörglases erreichen, das Sie ebenfalls mit Wasser verdünnen.
Wenn Sie gerade gegen eine ernsthaftere Krankheit oder Infektion kämpfen, nehmen Sie 1 EL der Antibiotika-Mischung fünf- bis sechsmal pro Tag (wiederum mit Wasser verdünnt) – je nach Verträglichkeit vor, zu oder nach den Mahlzeiten. Die Wirkung ist auf leeren Magen stärker, doch verträgt dies nicht jeder.
Als Kur (zur Prävention oder bei Krankheit) könnte man das Mittel beispielsweise 14 Tage lang nehmen, dann eine vierwöchige Pause einlegen und es erneut 14 Tage lang nehmen.
Kinder (bzw. deren Eltern) und Schwangere sollten die Einnahme mit dem jeweiligen Arzt besprechen.
Stillende Mütter sollten bedenken, dass das starke Aroma des natürlichen Antibiotikums in die Muttermilch übergehen könnte, was dem Säugling nicht unbedingt behagen muss. Wir empfehlen, vor der Anwendung in der Stillzeit, sich mit der Hebamme oder der Frauenärztin zu beraten.
Wenn Sie das natürliche Antibiotikum pur nehmen, können Sie nach der Einnahme eine Scheibe Orange oder Zitrone in den Mund nehmen, um die Schärfe im Mund zu lindern.
Sie können mit der verdünnten Mischung auch gurgeln.
Die natürliche Antibiotika-Mixtur kann natürlich auch in der Küche als Würze für Suppen und Eintöpfe verwendet werden. Gemixt mit Olivenöl entsteht ein hervorragendes, sehr gesundes Dressing.
Quelle: https://www.zentrum-der-gesundheit.de/bibliothek/medikamente/antibiotika-uebersicht/natuerliches-antibiotikum